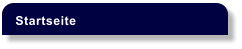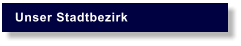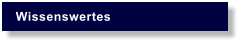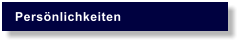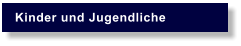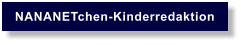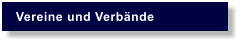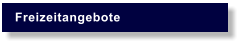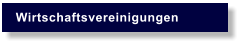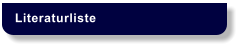© NANAnet Misburg-Anderten


Erinnerungen an die frühe Nachkriegszeit in Anderten
- Zufluchtsort und neues Zuhause in ungewohnter dörflicher Umgebung -
Bildbericht: Gisbert Selke
Bis zur Zerstörung Jerusalems am 15. März 1945
lebte ich im Schatten der Schornsteine der
Zementwerke. Meine frühkindliche
Erfahrungswelt beschränkte sich auf die nähere
Umgebung des Geschäftshauses, das meine
Großeltern 1913 gekauft hatten. Nach dem
frühen Tode meines Großvaters führte meine
Großmutter den Kolonialwaren bis zur Zerstörung
des Hauses weiter.
Vom Schützenplatz in Anderten aus lernte ich
das dortige dörfliche Leben und Land- und
Viehwirtschaft kennen.
Noch hatte ich nicht die Körpergröße, um über
die ausgedehnten Klinkerstein-Mauern, die die
Bauernhöfe umgaben, hinwegzusehen. Doch ab
und zu wurden die Mauern durch
schmiedeeiserne Tore oder Gartenpforten unterbrochen, durch die ich einen Blick auf die liebevoll
gepflegten Bauerngärten - eine Mischung aus Nutz- und Ziergärten - mit ihren Stauden,
Gemüsepflanzen und Kräutern werfen konnte. Hier klebte nicht der feine Rohmehlstaub an den
Zäunen, hier waren die Ziegeldächer nicht grau, sondern rot – eine andere, eine fremde Welt, obwohl
unser neues und in jeder Hinsicht primitives Zuhause nur zwei Kilometer vom heimatlichen „Jerusalem“
entfernt war.
Als wir in unsere Notunterkunft auf dem Schützenplatz einzogen, waren die Krokusse, Osterglocken
und Narzissen bereits verblüht. Der Frühling hatte begonnen. Bald würden die dicken Knospen der
Pfingstrosen aufbrechen und ihr verschwenderisches Blütenmeer entfalten. Hier und da kuschelten
sich kleine Gruppen von Stiefmütterchen in sonnige Nischen der Bauerngärten. Im Rasen des
Schützenplatzes blühten Löwenzahn und Gänseblümchen. Das gerade noch vorfrühlingshafte farblose
Anderten hüllte sich in sattes Grün, durchsetzt mit kräftigen Farben zahlreicher Frühlingsblüher. Das
leuchtende Gelb der Forsythien und Ranunkelsträucher signalisierte das Ende der kälteren
Jahreszeiten. An den Kastanien leuchteten die kerzenähnlichen Blüten; in den in grelles Weiß
gekleideten Obstbäumen summte und brummte es. Die welkenden Blüten der japanischen Zierkirschen
wurden von den Winden durch die Straßen getragen. Hier und da ragte ein Goldregenstrauch über die
Mauer. An den wenigen Koniferen waren bereits die jungen hellgrünen Triebe zu erkennen. Gut, dass
mit dem Ende des Krieges der Frühling begonnen hatte. So wohnten wir zwar recht einfach, aber wir
mussten nicht frieren. Meinen Eltern blieb noch etwas Zeit, unsere Behausung auf den nächsten Winter
vorzubereiten.
Wann immer es das Wetter zuließ, spielten wir „draußen“. Der Schützenplatz bot uns Platz genug.
Wenn die freiwillige Feuerwehr übte, waren wir Kinder immer zur Stelle. Nie hatte ich zuvor ein
Feuerwehrauto gesehen. Noch war der vor dem Spritzenhaus abgestellte Wagen in grüner Tarnfarbe
gespritzt. Dann und wann durften wir während des Gerätedienstes auf den Mannschaftssitzen Platz
nehmen. Das Gefühl, selbst einmal Feuerwehrmann spielen zu dürfen, ließ uns vergessen, dass wir
selbst kaum Spielzeuge besaßen.
Das ganze Dorf war unser Spielplatz. Es gab immer etwas zu beobachten. Die Erwachsenen
verscheuchten uns nicht, sondern luden uns ein zu „helfen“. Spiel wurde so zum Tun, Tätigkeit zum
Spiel.
Natürlich wichen wir den Gefahren aus.
Einen Bauernhof durfte man nicht
ungefragt betreten. Oftmals wachte ein
an langer Leine laufender Hund
darüber, dass wir dem Treiben auf dem
Hof nicht zu nahe kamen. Neben den
Hofeinfahrten lagerte ein an kühlen
Tagen dampfender Misthaufen, ein
Zeichen für die auf allen Höfen
praktizierte Viehhaltung.
Spezialisierungen waren damals noch
nicht üblich. Hühner, Enten und Gänse
gehörten ebenso zum Vieh wie
Kaninchen, Schafe, Ziegen, Schweine
und Rinder.
Niemals hatte ich in Misburg so viele
Gespanne gesehen wie jetzt täglich in
Anderten. Nur wenige Lanz-Traktoren
tuckerten durch die engen Straßen des
Dorfes. Im Standgas hoppelten die
Angst einflößenden Einzylinder-
Ungetüme Furcht erregend auf und
nieder. Aus deren offenen Kühlern stieg
eine feine Dampffahne auf wie aus dem
Schornstein einer kleinen Lokomotive.
Die wesentliche Feld- und
Transportarbeit geschah mit kräftigen
Ackerpferden, stattliche Tiere, die uns
Kindern viel Respekt einflößten und die
vom Pflug über diverse Landmaschinen
und Acker- bzw. Leiterwagen bis hin
zum gewaltigen dorfeigenen
Schneepflug alles zogen, was für die
Menschen allein nicht regierbar war. Ihr gemächliches rhythmisches Getrappel auf den mit großen
Steinen gepflasterten Dorfstraßen entbehrte jeglicher Hektik und signalisierte etwas
Entschleunigendes. Nur bei drohendem Regen oder aufziehendem Unwetter brachten die
Gespannführer – das war ein anerkannter Beruf in der Landwirtschaft – die hoch beladenen Ernte-
oder Heuwagengespanne auf Trab und lenkten sie mit konzentrierter Routine sicher auf die Höfe und in
die schützenden Scheunen.
Hörten wir beim Spielen ein schnelleres Getrappel, so gingen wir der drohenden Gefahr instinktiv
weiträumig aus dem Wege. Wer unter ein Gespann oder einen Erntewagen geriet, hatte kaum einen
Überlebenschance.
Unvergessen ist mir der sonore Klang
der Registrierkasse im Krackeschen
Kaufmannsladen an der Hohestraße.
Dort war das Sortiment noch breiter
aufgestellt als im ehemaligen Laden
meiner Oma Mathilde, ein Dorfladen,
in dem es alles Notwendige – selbst
Kohlen und Baustoffe - zu erwerben
gab. Damals konnte man nur
einkaufen, wenn man
Lebensmittelkarten besaß. Kaufleute
und Bäcker waren nicht frei wählbar.
Die winzigen Karten-Abschnitte durften
auf keinen Fall verloren gehen. Ersatz
hätte es nicht gegeben.
Den in Anderten gestrandeten
Ausgebombten und Flüchtlingen
wurden in den Rothwiesen jeweils 20 Ruten große Ackerstücke eingerichtet, auf denen Gemüse und
Kartoffeln angebaut werden konnten. Obst und Gemüse gehörte damals nicht zum Sortiment der
Kaufleute. Da Tabakwaren nach dem Kriege sehr knapp und vielfach unbezahlbar waren, wuchsen
neben dem Gemüse immer auch einige Tabakpflanzen heran. Die goldgelben Blätter wurden nach der
Ernte auf einen Bindfaden aufgespießt und zum Trocknen unter die Traufe der Baracke gehängt.
Noch im Sommer 1945 begannen die Schützenplatzbewohner damit, kleine Hühnerställe und Gelasse
zu bauen. Eintagsküken kaufte man in der Brutanstalt Siebecke am Eisteichweg. Die meisten Hennen
durften so lange leben, wie sie Eier legten. Darüber hinaus wurden sie als Glucken gebraucht. Hatte
eine Glucke ihre Küken ausgebrütet, wurden ihr bei Dunkelheit weitere Küken aus der Brutanstalt
untergeschoben, so dass sie sich immer um eine stattliche Zahl eigener und adoptierter Tiere zu
kümmern hatte. Ohne Hahn kein Nachwuchs im Federkleid. Der kräftigste Hahn hatte Vaterpflichten zu
übernehmen; die übrigen Hähnchen landeten als schmackhafte Abwechslung auf dem Festtagstisch.
Auf dem Schützenplatz fanden unsere Hühner genug Grünfutter, ein Schlaraffenland für das zahlreiche
Federvieh. Wie durch ein Wunder fand das Federvieh abends immer den heimatlichen Hühnerstall. Da
hockten sie dann auf dem „Wiemen“, den Sitzstangen für Hühner. Dort legten sie auch ihre Eier in die
eingerichteten Nester. Schweine und andere größere Tiere durften noch nicht wieder gehalten werden.
Als 1945 der Herbst begann, lernte ich das „Stoppeln“ kennen. Nach dem Abernten der Felder durften
die Getreidereste und abgeschlagenen Köpfe von Runkeln und Zuckerrüben gestoppelt, also
gesammelt werden. Die Bauern achteten streng darauf, dass sich niemand an den noch nicht
abgeernteten Flächen vergriff. Trotz aller Kontrollen machten es sich einige Sammler sehr leicht und
stahlen insbesondere Zuckerrüben. Damals lernte ich Begriffe wie Ehrlichkeit und Unehrlichkeit
kennen. Kommentar meiner Mutter: Junge, das ist nicht richtig; das tut man nicht.
Wichtigstes Transportmittel war das Fahrrad. Den ersten Sack mit dem Gestoppelten klemmte man auf
den Gepäckträger, den zweiten legte man in den Rahmen oberhalb des Tretlagers. Irgendwann hatte
unser Vater aber einen Handwagen organisiert, der schnell unser wichtigstes Fahrzeug wurde. Aus den
Rübenresten wurde von den Bewohnern des Schützenplatzes in den Kesseln der Küchenbaracke
Sirup gekocht. Wir Kinder durften gegen Ende des Kochvorgangs schon mal etwas von dem Schaum
probieren, der sich auf der Sirupmasse gebildet hatte.
Nicht alle Anderter hatten Verständnis für die Barackenbewohner auf dem Schützenplatz. Dennoch
habe ich hilfsbereite Menschen kennen gelernt, die uns heimlich mit Obst und Gemüse oder auch Milch
unterstützten. Manchmal luden sie mich
zum Essen ein oder erlaubten, mir die
Hosentasche mit Falläpfeln vollzustopfen.
Wenn ich heute durch das alte Dorf gehe,
erinnere ich mich noch genau an die Höfe
bzw. Häuser, in denen diese gutherzigen
Menschen wohnten und an deren Namen.
Sie halfen bereitwillig, obwohl sie von
niemandem dazu aufgefordert worden
waren. So werden sie immer zu den
bemerkenswerten Personen meiner
Lebensgeschichte gehören, halfen sie doch
unserer Familie, die schwere Zeit nach
Ausbombung und Kriegsende besser zu
überstehen.

Notunterkunft am Schützenplatz 1945 - 1952

Haus Selke vor der Zerstörung 1945


Quelle: Lorenz Kurz





Quelle: Lorenz Kurz