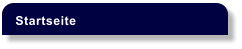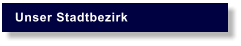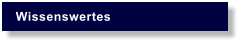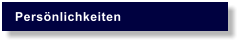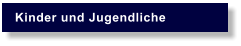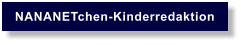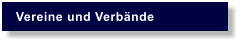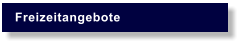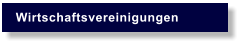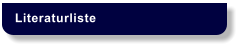© NANAnet Misburg-Anderten






Zwischen Krieg und Frieden – Neubeginn in Anderten
Erinnerungen an das Kriegsende 1945
Bildbericht: Gisbert Selke
Wenn ich heute zurückblicke, habe ich am 15. März
1945 nicht nur den „Untergang Jerusalems“ (Misburg-
Süd) miterlebt.
Bomben, Zerstörung und Flächenbrand hatten meiner
Familie die elementare Existenzgrundlage genommen.
Wir standen buchstäblich vor dem Nichts, zumal uns
nur das geblieben war, was wir auf dem Leibe trugen.
Als 1941 geborenes Kriegskind des Zweiten Weltkriegs
hatte ich eine äußerst schmerzhafte Zäsur erleben
müssen. Unser Zuhause war vernichtet, meine
vertraute Kinderkarre hing verbogen hoch oben in
einem der Kastanienbäume neben dem Bunker an der
Karlstraße, meine persönlichen Sachen, Spielzeuge,
Dreirad, Kuscheltier und Bilderbücher waren unter den
Trümmern unseres Hauses verbrannt. Noch wenige
Tage zuvor hatte ich aus einem Fenster unserer im
ersten Stock befindlichen Wohnung den „Volkssturm“ vorbeiziehen sehen und meinem Vater zugewinkt, der
dort mitmarschieren musste. Was hatte der Gleichschritt dieser zusammengesuchten Truppe zu bedeuten?
Warum war mein Vater nicht in seiner Anlage auf der Deurag-Nerag?
Auch mir, dem Vierjährigem, blieb nicht verborgen,
dass unser Leben vieles von seiner Normalität verloren
hatte. Seit Wochen musste ich mich ebenso wie meine
Brüder voll bekleidet schlafen legen, um beim fast
täglichen Fliegeralarm schnell in den schützenden
Bunker zu gelangen. Wer dort zu spät ankam, stand
vor verschlossen Türen. Meine Mutter hatte alles
planmäßig durchorganisiert, um uns vor den alliierten
Bomberverbänden in Sicherheit zu bringen.
Nach Ende des Infernos am Abend des 15. März 1945
war uns nur das nackte Leben geblieben, alles andere
hatten wir verloren. Einen Plan B für einen
Katastrophenfall solchen Ausmaßes gab es für unsere
Familie nicht, zumal auch alle am Ort wohnenden
Verwandten obdachlos geworden waren. Die Schulen
und öffentlichen Gebäude waren zerstört. Übrig blieb
eine tiefe Ratlosigkeit, wie es nach dieser
Schreckensnacht mit uns weitergehen konnte.
Am 19. März 1945 verließen wir den Bunker an der
Karlstraße schließlich, verabschiedeten uns von
unserem Vater, der in Misburg blieb, und fuhren mit der
Eisenbahn nach Celle zu meinen Großeltern. Eine
Sicherheit, dort heil anzukommen, hatten wir nicht. Die
Züge fuhren damals unpünktlich, waren hoffnungslos
überfüllt und gerieten vielfach unter Tiefflieger-
beschuss.
Als hinter uns die Tür zum Dritter-Klasse-Abteil ins
Schloss fiel und der Zug sich nach dem Abpfeifen
langsam in Bewegung setzte, ließ ich nicht nur meine
vertraute Heimat, sondern auch ein vom Bombenkrieg
geprägtes Kleinkindleben zurück. Explosionen und
Sirenengeheul schienen alle guten Erinnerungen an
mein junges Dasein aus dem Gedächtnis gelöscht zu haben. Traumatisiert flüchtete ich mich an den
Rockzipfel meiner Mutter und damit in die Geborgenheit meiner Familie, mit der ich nun auf dem Wege in
eine ungewisse Zukunft war.
Asyl in Celle
Rückschauend betrachtet, begann für mich eine neue
Lebensphase. Ein Mitspracherecht hatte ich nicht. Als
vierjähriges Kind war ich deutlicher als je zuvor ein
„Zögling“, im realen wie im übertragenen Sinne. Wenn
es schnell gehen musste, wurde ich von Mutter oder
den großen Brüdern im wahrsten Sinne hinterher-
gezogen. Entfernungen schienen mir endlos zu sein.
Um von A nach B zu kommen, gab es nur den Weg zu
Fuß. Ich hatte zum zweiten Mal das Laufen zu lernen.
Nach langsamer Eisenbahnfahrt mit zwischen-
zeitlichem Tieffliegerbeschuss zwischen Burgdorf und
Otze erreichten wir schließlich Celle, eine „Insel der
Seligen“. Keine Hochbunker, keine Zerstörungen wie in
Misburg, keine Bombentrichter, sondern geharkte
Fußwege und gepflegte Vorgärten. Mitten im zu Ende
gehenden Krieg umfing uns in Celle-Klein Hehlen ein
vorstädtisches Idyll mit angepflockten Schafen und
Ziegen, die auf der Auwiese grasten, Pferdefuhrwerken und scheinbar sorglosen Menschen.
Noch heute denke ich an den nicht enden wollenden Fußmarsch vom Celler Bahnhof nach Klein Hehlen zum
Haus meiner Großeltern. Endlich angekommen, klopfte Mutter an die Tür. Oma öffnete, dann zunächst Stille.
„Ihr seid ausgebombt“, sagte Oma schließlich. Stummes Nicken, wieder Stille. „Dann kommt erstmal herein.“
Nach 13 Jahren kehrt die älteste Tochter heim ins Elternhaus, vier Kinder an der Hand, obdachlos,
heimatlos, mittellos, scheinbar auch perspektivlos.
Ohne Vorwarnung muss nun in der kleinen Wohnung Platz für fünf weitere Personen geschaffen werden. Am
Esstisch wollen nun zukünftig neun Personen satt werden, denn neben meinen Großeltern wohnt in der
kleinen Wohnung auch die Schwester meiner Mutter mit ihrer vierjährigen Tochter. Ihr Mann ist als Soldat in
Jugoslawien.
Zum Trauern bleibt keine Zeit. Überlegungen müssen angestellt, Entscheidungen getroffen werden: Wie
steht es um die Gültigkeit der Lebensmittelkarten? Wo können Bezugsscheine beantragt werden. Wer
spendet Kleidung, Spielsachen und Bettzeug? Kurzerhand wird in der Stube ein Matratzenlager für meine
Brüder gebaut, Meine Mutter schläft bei ihrer jüngeren Schwester, ich finde Platz auf der „Besuchsritze“ im
Ehebett der Großeltern.
Weder nach der Bombardierung in Misburg noch nach der Einquartierung bei meinen Großeltern habe ich
meine Mutter weinen sehen. Musste nicht auch sie traumatisiert sein, brauchte sie nicht auch Trost und
Zuwendung? Auf sich allein gestellt – der Mann arbeitete nach wie vor im zerbombten Misburg – trieb sie die
Sorge um ihre Kinder um, eine starke Frau oder einfach nur eine Mutter, die bewusst in den Hintergrund trat,
aber dennoch ihr Ziel im Auge behaltend, ihre Kinder schadlos durch das Chaos zu bringen.
Im ehemaligen Elternhaus Asyl gefunden zu haben, trug vielleicht zur leichten Entschärfung der schier
ausweglosen Lage bei, die wegen der bedrückenden Enge keineswegs immer spannungsfrei verlief.
Der erste Eindruck, in Celle dem Bombenkrieg entkommen zu sein, stellte sich als sehr trügerisch heraus.
Nach einem unerwarteten Fliegeralarm und hastigem Gerenne zum Erdbunker an der Brücke neben der
„Petersburg“ in Klein Hehlen erlebten wir am 08. April 1945 die Bombardierung des Celler Bahnhofs und des
Fliegerhorsts Celle-Wietzenbruch. Bei schönem Wetter näherten sich gegen 18:00 Uhr 132 amerikanische
Bomber. In uns meldete sich die alte Angst. Waren wir dem Inferno entkommen und nun in ein neues
geraten? Konnte man diesem Bunker trauen oder war es nur ein besserer Splitterschutz? Gott sei Dank,
blieb es in Celle bei diesem einen schweren Bombenangriff, der sich zwei Kilometer entfernt ereignet hatte.
Über die schrecklichen Begleitumstände dieses Angriffs erfuhr ich erst viele Jahre später. Man nimmt an,
dass ungefähr 3000 Tote zu beklagen waren, denn bei dem Angriff wurde auf den Güterbahnhof auch ein
Häftlingstransport getroffen. Viele Häftlinge wurden getötet, jene, die fliehen konnten, wurden von Celler
Nazis und verblendeten Bürgern gejagt wie die Hasen, erschossen oder eingefangen und zu Fuß nach
Bergen-Belsen verbracht.
In den letzten Tagen vor der Besetzung Celles durch die Alliierten erlebte ich an der Hand meiner Tante auf
der Petersburgstraße den gnadenlosen Angriff eines alliierten Tieffliegers.
Auf dem Wege zum Schlachter gerieten wir in dessen Visier, obwohl er eigentlich hätte sehen können, dass
wir wehrlose Zivilisten waren. Wie groß musste der Hass am Ende dieses schrecklichen Krieges sein, der
solche Attacken zuließ? Geistesgegenwärtig zog mich meine Tante in den Schutz eines Kiefernwäldchens
neben der Straße. Sobald wir uns wieder auf den Weg machten, wurden wir wieder angegriffen. Damals
begriff ich dieses Versteckspiel hinter den Bäumen des Wäldchens nicht, wenn der Flieger ein weiteres Mal
die Straße entlangfeuerte.
War es ein Spiel, das meine Tante mit mir veranstaltete? -
Nein, bitterer Ernst!
Damals war mir nicht bewusst, dass mein Leben in diesen Apriltagen des zu Ende gehenden Krieges wieder
einmal am seidenen Faden gehangen hatte. Hinter den Bäumen des Kiefernwäldchens versteckten wir uns
so lange, bis die Tieffliegergefahr vorbei war, denn auf dem Wege zum Schlachter mussten wir im Zuge der
Petersburgstraße eine Brücke über die Eisenbahn überqueren. Dort hätte es für uns keinen Schutz gegeben.
Der Garten meiner Großeltern grenzte direkt an die Strecke der Osthannoverschen Eisenbahn. Fasziniert
betrachtete ich die an der Steigungsstrecke in Richtung Celle-Vorstadt sehr langsam fahrenden Güterzüge.
Auf den offenen Wagen wurde Kriegsgerät transportiert. Auch nachts schnauften die Züge in Richtung
Bergen, Soltau und Munster. Ahnten die Erwachsenen, dass darunter auch Häftlingszüge auf dem Wege
nach Bergen-Belsen waren? Selbst als ich älter war, wurde über dieses dunkle Kapitel der Geschichte kaum
gesprochen. In Erinnerung aus dem Jahre 1945 sind mir nur die Züge mit siegesgewiss winkenden
britischen Soldaten geblieben, die zu Kriegsende auf dem Wege zu ihren neuen Quartieren in der Heide
waren.
Auch in Celle selbst gehörten die britischen Truppen gegen Kriegsende zum Straßenbild. In einer Villa am
Bremer Weg hatte Oberbefehlshaber General Montgomery sein Hauptquartier aufgeschlagen und die
vorhandenen Kasernen an der Hannoverschen Heerstraße und in Celle-Vorwerk an der Harburger
Heerstraße dienten nun als Unterkünfte für die Besatzungssoldaten. Anstelle der zu Kriegsende gesprengten
Allerbrücke errichteten britische Pioniere im Zuge der Reichsstraße 3 (heute B 3) kurzfristig eine
Behelfsbrücke, über die der gesamte Verkehr von und nach Hamburg floss.
Nach wie vor bleibt für mich rätselhaft, wie es Oma schaffte, uns satt zu bekommen. Dank des Gartens
waren meine Großeltern zum Teil Selbstversorger. Gemüse und Obst wuchsen im Garten. Was nicht frisch
gegessen wurde, wurde eingemacht. Der Keller war mit unterschiedlichsten Einweckgläsern gefüllt. Rüben
waren über den Winter eingemietet. Aus Ziegenmilch wurde Butter gemacht, die mir großartig schmeckte.
Omas Steckrübeneintopf ist mir unvergesslich, zumal sie es verstand, durch geschicktes süß-saures Würzen
den strengen herben Geschmack zu neutralisieren. Gern aß ich die Brotrinden, die Oma und Opa mit ihren
wenigen gesunden Zähnen nicht mehr kauen konnten. Mit dem Spruch, „die Rinde gehört dem Kinde“,
legten sie uns Kindern die knusprigen ovalen Gebilde auf den Teller. Streng wurde darauf geachtet, dass
keine Lebensmittel verdarben – Oma sagte immer: „Nichts darf umkommen“ - . Alle Reste wurden geschickt
in den Speiseplan eingearbeitet.
Ein Frieden der Entbehrungen in Anderten
Ich erinnere mich nicht mehr genau an den Tag unserer Rückkehr. Der Krieg war am 8. Mai 1945 zu Ende.
Vater hatte für uns zwischenzeitlich eine der rund um den Schützenplatz in Anderten errichteten
Wehrmachtsbaracken hergerichtet. Nachdem die dort zum Schutz der Hindenburgschleuse stationierten
Soldaten in Gefangenschaft geratenen waren, fanden dort ausschließlich Ausgebombte aus Misburg-Süd ein
vorläufiges Zuhause. Heute würde man sicherlich von einer „Hausbesetzung“ sprechen. Damals waren die
für die öffentliche Ordnung Verantwortlichen sicherlich froh, dass obdachlose Menschen eine notdürftige
Unterkunft gefunden hatten.
Als uns Vater in Celle abholte, hatte der Frieden begonnen. Aber was war das, Frieden, diese große
„Unbekannte“ in meinem jungen Leben? Seit meiner Geburt hatte ich nur Bombenkrieg mit Angst und
Zerstörung erlebt. Nun schwiegen die Sirenen; der Zug wurde auf der Heimfahrt nicht mehr beschossen. Es
herrschte das schönste Frühlingswetter. Aber war dies nicht eine Fahrt in eine fremde Welt. Wo würden wir
künftig wohnen? „Mein Jerusalem“ war unbewohnbar, unser Haus ein riesiger Trümmerhaufen.
Unser neuer Nach-Hause-Weg führte vom
Bahnhof Anderten-Misburg zunächst auf die
Hindenburgschleuse zu. Über die kleine
Schleusenbrücke am Unterhaupt gelangten wir
zum Anderter Schützenplatz. Schließlich
standen wir staunend vor einer lang
gestreckten Mannschaftsbaracke, die Vater mit
Hilfe von Hartfaserplattenwänden in vier kleine
Räume gegliedert hatte. Rechts neben der
Eingangstür befand sich neben der Küche das
Elternschlafzimmer. Auf der linken Seite
schloss sich der Raum an, der einmal die
Stube werden sollte und von dort gelangte man
in das Kinderzimmer. Für jeden von uns hatte
Vater ein schmales Wehrmachtsbett
organisiert. Wir schliefen auf Strohsäcken und
deckten uns mit geschenkten Betten und
Decken zu.
Unsere wenigen Kleidungsstücke brachte Mutter in zwei Wehrmachtsspinden unter. Hocker dienten als erste
Sitzgelegenheit. Aus dem Bekanntenkreis bekamen wir notwendiges Geschirr und Töpfe. Je ein
Wehrmachtstisch stand in der Küche und in der Stube. Irgendwoher hatte Vater einen alten Herd organisiert
und in der Stube stand ein Ofen. Trinkwasser musste in Eimern von einer entfernten Wasserstelle geholt
werden. Zwischen den Baracken befand sich ein Plumpsklo. Rechts neben der Baracke hatte Vater einen
kleinen Schuppen in Besitz genommen, damit für Handwagen, Fahrräder oder Geräte, Platz war.
Nach und nach gewöhnten wir uns an das neue Notquartier. Ich lernte schnell, mich in dem mir unbekannten
Anderten, das so anders war als das heimatliche „Jerusalem“, zurechtzufinden. Oma Mathilde Selke, die
„Laden-Oma“, bewohnte gemeinsam mit meiner Tante Elisabeth, meiner Tante Anna und ihrem Sohn Albert
eine uns gegenüber liegende Baracke. Auch sie waren wie wir am 15. März 1945 total ausgebombt.
Nun hatten wir Frieden. Doch was war das? Die jämmerlichen Begleitumstände wurden mir als Kind kaum
bewusst, denn ich hatte ja keinerlei Vergleiche. Mein bisheriges junges Leben verlor de facto nichts von
seiner Abnormität. Frieden setzte ich mit Barackenleben gleich, Wasser eimerweise von einer entfernten
Wasserstelle zu holen, zu frieren, auf Strohsäcken zu schlafen, ein Plumpsklosett zu benutzen, zu kleine
Schuhe tragen zu müssen und häufig streng rationiert zu essen. Meine Eltern konnten ihre großen Sorgen
nicht verbergen, denn sie spiegelten sich in deren verhärmten Gesichtern wider. Ein Glück für mich: Ich lebte
im Jetzt, und nicht perspektivisch. Die tägliche Verwaltung des Mangels blieb mir Vierjährigen in weiten
Teilen verborgen.
Die Sehnsucht nach einem besseren Morgen hatte ich noch nicht entwickelt. Das Heute, das gegenwärtig
Erlebte ließ mich fröhlich sein oder traurig. Traumatische Schädigungen waren mir nicht bewusst, obwohl ich
im Verborgenen sicherlich darunter zu leiden hatte. Es mangelte mir nicht an Spielgefährten in ähnlicher
Lage. Unser Spiel- und Erfahrungsbereich erweiterte sich von Tag zu Tag.
Gleich nach Kriegsende zog eine britische Bergepanzer-Einheit in Anderten ein. Ihre Aufgabe bestand darin,
die Feldwege der Gemarkung wieder passierbar zu machen. Denn diese waren vielfach durch
Bombentrichter unpassierbar geworden. Auch auf den Feldern mussten zahlreiche Krater zugeschoben
werden, um die Äcker bestellen zu können. Schlechte Ernteerträge hätten für uns katastrophale Folgen
gehabt.
Fasziniert betrachteten wir die mit grüner Tarnfarbe gestrichenen, stählernen Ungetüme mit ihren mächtigen
Schilden in der Alten Bahnhofstraße (heute Gollstraße). Auf den Panzern langweilten sich junge Soldaten
und sprachen uns neugierige Kinder an. Unsere Angst vor ihnen verflog schnell, als sie jedem von uns eine
Scheibe Weißbrot anboten. Danach bekam jeder noch einen Riegel Blockschokolade. Das Weißbrot aß ich
schnell auf. Der braune Riegel war mir unbekannt. So lief ich umgehend nach Hause. Als ich vor meiner
Mutter fragend die Faust öffnete, die das süße und bereits zerfließende, unbekannte braune Etwas
umschloss, sagte sie nicht, „das ist Schokolade“, sondern ermunterte mich hastig: „Iss schnell auf!“ Seitdem
verbinde ich meine erste direkte Konfrontation mit der Besatzungsmacht mit einer Scheibe Weißbrot und
einem wohlschmeckenden Riegel Blockschokolade.

Haus Selke vor der Zerstörung 1945

Bunker Karlstraße 1986

Bunker - Treppenaufgang

Haus der Großeltern in Celle-Klein Hehlen

Notunterkunft am Schützenplatz 1945 - 1952